Prof. Dr. Dr. Martin Sedlmayr schafft im Rahmen der Professur für Medizinische Informatik ein digitales Ökosystem für die medizinische Forschung und Versorgung.
Zehntausende Behandlungsdaten laufen jeden Tag allein im Universitätsklinikum Dresden auf. Das Potenzial dieser Informationen lässt sich allerdings auch in Zeiten komplexer und leistungsfähiger Datenverarbeitung nur sehr bruchstückhaft nutzen. Um Impulse für die patientennahe Forschung zu setzen, fördert die Bundesregierung den Ausbau der Medizininformatik an den Universitätsklinika. Im Rahmen des MIRACUM-Konsortiums wird deshalb auch in Dresden an Systemen gearbeitet, die künftig diagnostische und klinische Daten wissenschaftlich nutzbar machen. Dazu entsteht ein Datenintegrationszentrum, das den Wissenschaftlern und Medizinern den Weg zu einer automatisierten Auswertung der benötigten Daten ebnet. Ziel ist ein „digitales Ökosystem“.
Datenverknüpfung sorgt für Mehrwert in der Forschung
Nicht nur in Bezug auf die Zahl der Probanden gelten bei Studien des 21. Jahrhunderts deutlich höhere Anforderungen. Allein der Umfang der Daten, die heute für valide Forschungsprojekte notwendig sind, macht es unmöglich, eine Untersuchung allein mit Stift und Papier zu dokumentieren und auszuwerten. Außerdem ist es trotz der großen Fortschritte in der Informationstechnologie längst nicht mehr damit getan, die Zahlen und Fakten für eine automatisierte Auswertung aufzubereiten und zu speichern. „Wir wollen die Daten so verknüpfen, dass die Forscher daraus einen Mehrwert schöpfen können“, sagt Prof. Dr. Dr. Martin Sedlmayr. Der Medizininformatiker, der im Frühjahr 2018 aus der Uni Erlangen an die Hochschulmedizin Dresden wechselte, beschreibt dieses dringend benötigte Umfeld für die Daten aus Forschung und Krankenversorgung als „Ökosystem“.
Täglich neue Datenmengen
Bei jährlich 60.000 stationären und 230.000 ambulanten Patienten kommen am Universitätsklinikum Tag für Tag mehrere zehntausend Daten zusammen. Doch trotz eines zentralen Krankenhaus-Informationssystems führen viele davon ein abgeschottetes Dasein in eigens dafür errichteten Silos. So lange es allein um die Steuerung von Klinikprozessen geht, sind die meisten Nutzer zufrieden. Aus der Perspektive der Maximalversorgung oder eines forschenden Arztes sieht das jedoch ganz anders aus. Hier macht es durchaus Sinn, Patienten-Informationen aus möglichst vielen Quellen automatisiert miteinander zu verknüpfen – etwa um Ursachen für eine Erkrankung zu finden oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie so viele Aspekte wie möglich zu erfassen. „Bei einem Patienten mit Atemwegsproblemen könnte beispielsweise ein Hinweis erscheinen, ob er in einem Stadtteil mit erhöhten Feinstaubwerten lebt oder nicht“, sagt Prof. Sedlmayr. Dies sei nur eine Chance, Daten unterschiedlicher Quellen automatisch zu verknüpfen – in diesem Fall Diagnose, Information zum Wohnort sowie die Umweltdaten.
Kompetenter Umgang mit den Daten entscheidend
Doch so einfach und verlockend eine IT-basierte Auswertung unterschiedlicher Daten ist – eine reine Korrelation führt Forschende häufig auf den Holzweg. Wie hoch das Risiko ist, bei unkritischem Vorgehen danebenzuliegen, hat der Harvard-Jurist Dr. Tyler Vigen an 99 Beispielen festgemacht. So fand er einen statistischen Zusammenhang zwischen der Scheidungsrate in Maine und dem Pro-Kopf-Verbrauch an Margarine, der in diesem US-Bundesstaat überdurchschnittlich hoch ist. Auch ohne diese skurrilen Beispiele bleiben Medizininformatiker wie Prof. Dr. Dr. Sedlmayr eher skeptisch, wenn es um Projekte geht, bei denen möglichst große Datenmengen der Schlüssel für eine effizientere und kompetentere Medizin sein sollen. „Wir brauchen nicht nur mehr Daten, sondern auch einen kompetenten Umgang damit“, sagt er.
Der Medizininformatik geht es nicht um simple Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen, sondern darum, dass durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens entstandene Potenzial zu heben und Medizinern, Patienten und Forschern nützliche Werkzeuge an die Hand zu geben. Im Rahmen der Medizininformatik-Initiative (MI-I) des Bundesforschungsministeriums (BMBF) formierte sich 2016 das Forschungskonsortium MIRACUM, dem seit 2018 auch das Universitätsklinikum Dresden angehört. Mittlerweile zehn Universitätsklinika, zwei Hochschulen und ein Industriepartner aus sieben deutschen Bundesländern haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, klinische Daten, Bilddaten und Daten aus molekularen beziehungsweise genomischen Untersuchungen sowohl standortbezogen als auch standort-übergreifend nutzbar zu machen.
Datenvernetzung noch kein Standard im Gesundheitswesen
Der internationale Standard Health Level 7 (HL7) zum Austausch von Daten zwischen Organisationen im Gesundheitswesen und deren Computersystemen geht zurück bis in die 1980er Jahre und hat bis heute weltweit Bestand. In der Entstehungszeit ging es darum, Patientendaten für einzelne Aufträge zu verarbeiten, nicht aber den kompletten Behandlungsablauf eines Patienten zu betrachten. Beispielsweise ersetzten die neuen IT-Systeme papierne Laufkarten für eine Blutuntersuchung, wodurch die Kommunikation zwischen den Medizinern schneller und verlässlicher wurde. Eine komplexere Vernetzung mit anderen Informationen fand nicht statt und ist auch heute noch kein Standard in der Krankenversorgung.
Innovationsimpuls durch komplexe Themen und Algorithmen
Mit der Medizininformatik-Initiative des BMBF erhält dieser dringend benötigte Innovationsimpuls nun die entsprechende Aufmerksamkeit. Modular aufgebaute, skalierbare und föderierte Forschungsprojekte sollen Lösungen entwickeln, um verfügbare medizinische Daten institutionsübergreifend nutzbar zu machen. Als Knotenpunkte dienen Datenintegrationszentren, die zum Beispiel das Rekrutieren von Patienten für klinische Studien, das Entwickeln von Prädiktionsmodellen sowie die Präzisionsmedizin unterstützen werden. Um die biomedizinische Informatik und Medical Data Science zu stärken, werden an den MIRACUM-Standorten mehr als 14 neue Professuren geschaffen. Eine davon ist die von Prof. Dr. Dr. Martin Sedlmayr. Unter seiner Leitung entsteht am Uniklinikum derzeit eine praxisnah agierende Arbeitsgruppe, deren Mission es ist, tradierte Grenzen zwischen Kerninformatik, Medizininformatik und Bioinformatik aber auch Medizintechnik sowie weiteren Fachgebieten aufzulösen. Basis für diesen neuen Ansatz sind die durch die IT geschaffenen komplexen Systeme und Algorithmen. Die medizinische Informatik erfährt damit einen Wandel, weg von eher klassischen Themen der Krankenhaus-IT hin zu digitalen Ökosystemen für die medizinische Forschung und Krankenversorgung.
Daten müssen genutzt statt abgeschottet werden
Statt Patientendaten in hermetisch abgeschotteten Silos zu lagern, sollen sie wissenschaftlich nutzbar gemacht werden. Wie die häufig aufwändige und nicht selten erfolglose Suche nach Probanden für Studien zeigt, ist ein „digitales Ökosystem“ durchaus im Sinne der Patienten. „Viele medizinische Studien scheitern heute, weil nicht genügend Probanden eingeschlossen werden können. Das verzögert den Fortschritt der Medizin und kostet hunderte Millionen Euro jährlich. Wenn es uns gelingt, die Daten aus der Krankenversorgung zu nutzen, um sie automatisiert mit Einschlusskriterien klinischer Studien abzugleichen, lassen sich deutlich mehr Menschen finden, die für bestimmte Forschungsvorhaben geeignet sind“, erklärt Prof. Dr. Dr. Sedlmayr.
Kein Widersprich zum Datenschutz
Hier erfolgreich zu agieren, hängt nicht nur von entsprechenden IT-Kapazitäten und Algorithmen ab, sondern von einem Bewusstseinswandel bei Patienten und Ärzten. „Wir beobachten einen Kulturwandel in der Medizin. Die Erkenntnis setzt sich durch, dass wir medizinischen Fortschritt nur noch durch gemeinsame Forschung erreichen. Das Zurückhalten von Daten ist genauso unethisch wie sie zu missbrauchen“, sagt der Medizininformatiker. Sein Plädoyer für Datasharing steht keineswegs in Widerspruch mit dem Datenschutz. Prof. Dr. Dr. Sedlmayr und seine Fachkollegen arbeiten im Rahmen der Medizininformatik-Initiative an Ansätzen, um trotz der notwendigen Transparenz die Anonymität der Daten auf höchstem Niveau sicherzustellen.
Text: Philipp Demankowski








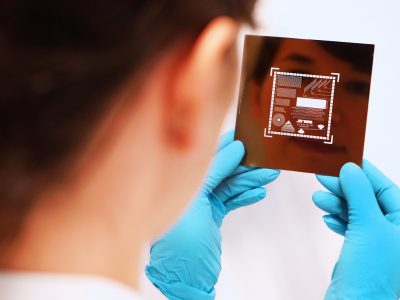





Kommentare